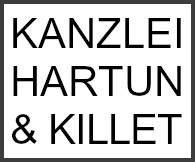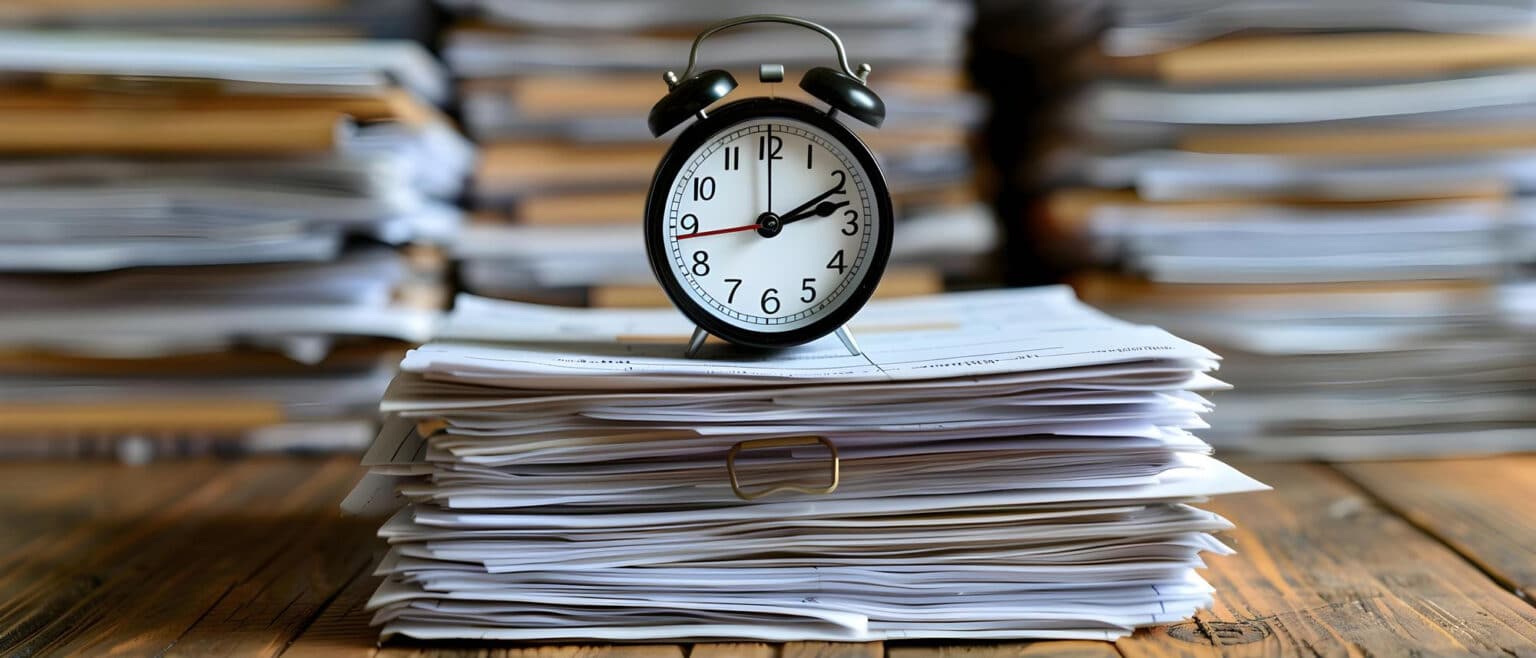Das Wichtigste im Überblick:
- Anteiliger Urlaubsanspruch besteht: Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben Sie Anspruch auf den bis zum Ausscheiden entstandenen anteiligen Jahresurlaub nach § 5 BUrlG
- Abgeltung bei nicht genommenem Urlaub: Nicht genommener Urlaub muss grundsätzlich finanziell abgegolten werden, außer bei eigenverantwortlicher Nichtnahme
- Besondere Regelungen je nach Beendigungsgrund: Kündigung, Aufhebungsvertrag oder Befristungsende können unterschiedliche Auswirkungen auf den Urlaubsanspruch haben
Urlaub am Ende des Arbeitsverhältnisses
Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses wirft viele rechtliche Fragen auf – eine der häufigsten betrifft den noch nicht genommenen Urlaub. Millionen von Arbeitnehmern in Deutschland stehen jährlich vor der Situation, dass ihr Arbeitsverhältnis endet, während sie noch offene Urlaubstage haben oder sich fragen, ob ihnen überhaupt noch Urlaub zusteht.
Das Urlaubsrecht ist komplex und wird häufig missverstanden. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sind oft unsicher, welche Ansprüche bestehen und wie diese zu behandeln sind. Fehler bei der Abwicklung können zu kostspieligen Auseinandersetzungen führen und das Ende des Arbeitsverhältnisses belasten.
Die rechtlichen Grundlagen finden sich hauptsächlich im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), werden aber durch Arbeitsverträge, Tarifverträge und die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts konkretisiert. Eine genaue Kenntnis dieser Regelungen ist essentiell für eine korrekte Abwicklung. Beratung durch einen Anwalt für Arbeitsrecht schafft hier Klarheit.
Rechtliche Grundlagen des Urlaubsanspruchs
Das Bundesurlaubsgesetz als Fundament
Das Bundesurlaubsgesetz bildet die zentrale Rechtsgrundlage für alle Urlaubsansprüche in Deutschland. Nach § 1 BUrlG hat jeder Arbeitnehmer in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Dieser Mindestanspruch beträgt nach § 3 BUrlG 24 Werktage bei einer Sechstagewoche, was 20 Arbeitstagen bei einer Fünftagewoche entspricht.
Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses regelt § 5 BUrlG die Abgeltung von Urlaubsansprüchen. Diese Vorschrift bestimmt sowohl den anteiligen Urlaubsanspruch als auch die Voraussetzungen für eine finanzielle Abgeltung nicht genommenen Urlaubs.
Ergänzende Regelungen im BGB
Neben dem Bundesurlaubsgesetz finden auch die allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) Anwendung. Insbesondere die Regelungen über Treu und Glauben nach § 242 BGB sowie die allgemeinen Vorschriften über die Beendigung von Dauerschuldverhältnissen, insbesondere in den §§ 623 ff. BGB, können relevant werden.
Bei der Berechnung von Urlaubsabgeltungen greifen zudem die Bestimmungen über die Vergütung von Arbeitnehmern nach §§ 611 ff. BGB. Diese Vorschriften bestimmen, wie die finanzielle Abgeltung zu berechnen ist und welche Vergütungsbestandteile zu berücksichtigen sind.
Entstehung des anteiligen Urlaubsanspruchs
Grundsätze der anteiligen Berechnung
Der Urlaubsanspruch entsteht nicht erst mit Ablauf des Kalenderjahres, sondern wächst kontinuierlich mit jedem gearbeiteten Monat an. Dies ergibt sich aus § 5 Abs. 1 BUrlG, wonach der Arbeitnehmer nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf den vollen Jahresurlaub hat.
Bei kürzerer Beschäftigungsdauer oder bei Beendigung während des Kalenderjahres entsteht ein anteiliger Urlaubsanspruch. Dieser berechnet sich nach der Formel: Jahresurlaub geteilt durch zwölf Monate, multipliziert mit den Monaten der Beschäftigung. Dabei werden auch angefangene Monate berücksichtigt, wenn das Arbeitsverhältnis mindestens zur Hälfte des Monats bestand.
Besonderheiten bei verschiedenen Arbeitszeiten
Die Berechnung des anteiligen Urlaubsanspruchs hängt von der vereinbarten Arbeitszeit ab. Bei Vollzeitbeschäftigung erfolgt die Berechnung standardmäßig auf Basis einer Fünf- oder Sechstagewoche. Teilzeitbeschäftigte haben Anspruch auf einen entsprechend reduzierten Urlaub.
Komplexer wird die Berechnung bei wechselnden Arbeitszeiten oder bei Arbeitnehmern mit unregelmäßigen Arbeitsmustern. Hier muss eine durchschnittliche Arbeitszeit zugrunde gelegt werden, um den korrekten anteiligen Urlaubsanspruch zu ermitteln.
Urlaubsabgeltung bei Beendigung
Voraussetzungen für die Abgeltung
Die finanzielle Abgeltung nicht genommenen Urlaubs ist nach § 5 BUrlG grundsätzlich nur bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zulässig. Während des laufenden Arbeitsverhältnisses ist eine Abgeltung des Urlaubs durch Geld grundsätzlich ausgeschlossen, da der Urlaub dem Schutz der Gesundheit und Erholung dient.
Entscheidend für den Urlaubsabgeltungsanspruch ist, dass der Urlaub aus betrieblichen Gründen oder wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr genommen werden kann. Hat der Arbeitnehmer hingegen eigenverantwortlich auf die Urlaubsnahme verzichtet, kann der Abgeltungsanspruch unter bestimmten Umständen entfallen, es sei denn, der Arbeitnehmer kann begründete, außerhalb seines Einflussbereichs liegende Gründe für die Nichtnahme nachweisen.
Berechnung der Urlaubsabgeltung
Die Höhe der Urlaubsabgeltung entspricht der Vergütung, die der Arbeitnehmer während des nicht genommenen Urlaubs erhalten hätte. Grundlage ist das durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten 13 Wochen vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Bei der Berechnung sind alle regelmäßigen Vergütungsbestandteile zu berücksichtigen. Dazu gehören neben dem Grundlohn auch regelmäßige Zulagen, Zuschläge und sonstige Vergütungsbestandteile. Variable Bestandteile wie Provisionen oder Boni sind anteilig einzubeziehen, soweit sie regelmäßig gezahlt werden.
Verschiedene Beendigungsarten und ihre Auswirkungen
Ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber
Bei einer ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer grundsätzlich Anspruch auf seinen vollen anteiligen Urlaubsanspruch bis zum Beendigungszeitpunkt. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, den noch offenen Urlaub während der Kündigungsfrist zu nehmen.
Ist die Urlaubsnahme während der Kündigungsfrist nicht möglich oder nicht zumutbar, besteht ein Anspruch auf Urlaubsabgeltung. Dies gilt insbesondere bei kurzen Kündigungsfristen oder wenn betriebliche Gründe einer Urlaubsgewährung entgegenstehen.
Kündigung durch den Arbeitnehmer
Auch bei einer Kündigung durch den Arbeitnehmer bleiben die Urlaubsansprüche grundsätzlich bestehen. Der Arbeitnehmer sollte jedoch bereits bei der Kündigung seinen Urlaubswunsch anmelden und versuchen, den Urlaub während der Kündigungsfrist zu nehmen.
Problematisch kann es werden, wenn der Arbeitnehmer kurzfristig kündigt und dadurch die Urlaubsnahme erschwert. In solchen Fällen kann der Arbeitgeber unter Umständen argumentieren, dass der Arbeitnehmer selbst für die Nichtinanspruchnahme verantwortlich ist.
Aufhebungsvertrag und einvernehmliche Beendigung
Bei einem Aufhebungsvertrag haben die Parteien die Möglichkeit, die Behandlung des Urlaubs individuell zu regeln. Oft wird vereinbart, dass der Arbeitnehmer den noch offenen Urlaub bis zum Beendigungstermin nimmt oder dass eine entsprechende Abgeltung erfolgt.
Wird im Aufhebungsvertrag nichts zum Urlaub geregelt, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Der Arbeitnehmer behält seinen Anspruch auf anteiligen Urlaub und gegebenenfalls auf Abgeltung nicht genommener Urlaubstage.
Befristete Arbeitsverhältnisse
Bei befristeten Arbeitsverhältnissen gelten dieselben Grundsätze wie bei unbefristeten Verträgen. Der Arbeitnehmer erwirbt einen anteiligen Urlaubsanspruch entsprechend seiner Beschäftigungsdauer. Bei Ende der Befristung muss nicht genommener Urlaub abgegolten werden.
Besondere Aufmerksamkeit erfordern kettenweise befristete Verträge mit demselben Arbeitgeber. Hier können sich Urlaubsansprüche aus verschiedenen Vertragsperioden akkumulieren, wenn zwischen den Verträgen nur kurze Unterbrechungen liegen.
Praktische Fallbeispiele und Szenarien
Szenario 1: Kündigung zur Jahresmitte
Frau Weber arbeitet seit dem 1. Januar in einem Unternehmen mit 30 Urlaubstagen pro Jahr. Am 30. Juni wird ihr ordentlich zum 31. August gekündigt. Bis zur Kündigung hat sie bereits 10 Urlaubstage genommen. Ihr stehen bis Ende August 20 anteilige Urlaubstage zu (8 Monate × 2,5 Tage). Sie hat somit noch Anspruch auf 10 weitere Urlaubstage, die während der Kündigungsfrist genommen oder abgegolten werden müssen.
Szenario 2: Kurzfristige Eigenkündigung
Herr Müller kündigt am 15. November mit einer Frist von zwei Wochen zum 30. November. Er hat in diesem Jahr noch 8 Urlaubstage offen. Da die kurze Restzeit eine Urlaubsnahme praktisch unmöglich macht, hat er Anspruch auf Abgeltung der 8 Tage, sofern er nicht selbst für die späte Kündigung verantwortlich gemacht werden kann.
Szenario 3: Aufhebungsvertrag mit Freistellung
Familie Schmidt und der Arbeitgeber vereinbaren einen Aufhebungsvertrag zum 30. Juni mit sofortiger Freistellung. Herr Schmidt hat noch 15 Urlaubstage offen. Im Aufhebungsvertrag wird vereinbart, dass die Freistellung als bezahlter Urlaub gilt. Er erhält somit sein volles Gehalt bis zum Ende und seine Urlaubsansprüche sind abgegolten.
Besondere Situationen und Problemfälle
Krankheit während der Kündigungsfrist
Wird der Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist krank, hat dies Auswirkungen auf die Urlaubsnahme. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts verfällt Urlaub nicht durch Krankheit. Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass der Urlaub nach der Genesung gewährt wird oder andernfalls abgegolten wird.
Kompliziert wird es, wenn die Krankheit bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses andauert. In diesem Fall muss der nicht genommene Urlaub vollständig abgegolten werden, da eine nachträgliche Urlaubsnahme nicht mehr möglich ist.
Urlaubsübertrag aus dem Vorjahr
Nicht genommener Urlaub aus dem Vorjahr kann die Berechnung verkomplizieren. Grundsätzlich verfällt Urlaub am Ende des Kalenderjahres, es sei denn, dringende betriebliche oder persönliche Gründe haben die Urlaubsnahme verhindert. Übertragener Urlaub muss bis zum 31. März des Folgejahres genommen werden.
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind auch übertragene Urlaubstage abzugelten, sofern sie nicht bereits verfallen sind. Dies erfordert eine genaue Prüfung der Umstände, die zur Übertragung geführt haben.
Teilzeitbeschäftigung und Arbeitszeitschwankungen
Bei Teilzeitbeschäftigung oder schwankenden Arbeitszeiten ist die Berechnung des Urlaubsanspruchs komplex. Maßgeblich ist die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit. Änderungen der Arbeitszeit während des Kalenderjahres müssen anteilig berücksichtigt werden.
Besonders schwierig ist die Situation bei Arbeitnehmern mit sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten oder bei geringfügiger Beschäftigung. Hier muss im Einzelfall geprüft werden, wie der korrekte Urlaubsanspruch zu berechnen ist.
Verjährung und Ausschlussfristen
Gesetzliche Verjährungsfristen
Urlaubsabgeltungsansprüche unterliegen der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren nach § 195 BGB. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat.
In der Praxis bedeutet dies, dass Urlaubsabgeltungsansprüche aus einem im Jahr 2022 beendeten Arbeitsverhältnis grundsätzlich bis Ende 2025 geltend gemacht werden können. Diese lange Frist gibt Arbeitnehmern ausreichend Zeit, ihre Ansprüche durchzusetzen.
Tarifliche und vertragliche Ausschlussfristen
Viele Arbeitsverträge und Tarifverträge enthalten jedoch kürzere Ausschlussfristen. Diese bestimmen, dass Ansprüche innerhalb einer bestimmten Frist nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden müssen, andernfalls verfallen sie.
Typische Ausschlussfristen betragen drei bis sechs Monate. Arbeitnehmer sollten daher ihre Urlaubsabgeltungsansprüche zeitnah nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses schriftlich geltend machen, um einen Verfall durch Ausschlussfristen zu vermeiden.
Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Aspekte
Besteuerung der Urlaubsabgeltung
Urlaubsabgeltungen unterliegen grundsätzlich der Lohnsteuer und sind als Arbeitslohn zu behandeln. Hinsichtlich der Sozialversicherungspflicht unterliegen die Abgeltungen den üblichen Beitragspflichten, soweit sie innerhalb der Beitragsbemessungsgrenzen liegen. Sie werden dem Lohnsteuerjahr zugerechnet, in dem das Arbeitsverhältnis endet, nicht dem Jahr, für das der Urlaub ursprünglich gewährt wurde.
Bei höheren Abgeltungsbeträgen kann sich die Anwendung der Fünftelregelung nach § 34 EStG lohnen, wenn die Abgeltung eine außergewöhnliche Einkunft darstellt. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich und sollte steuerlich geprüft werden.
Sozialversicherungsbeiträge
Urlaubsabgeltungen sind grundsätzlich sozialversicherungspflichtig, soweit sie die Beitragsbemessungsgrenzen nicht überschreiten. Es fallen Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung an. Die Beiträge werden sowohl vom Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber getragen.
Bei der Berechnung der Beiträge sind die aktuellen Beitragsbemessungsgrenzen zu beachten. Übersteigt die Abgeltung zusammen mit anderen Bezügen die Beitragsbemessungsgrenze, fallen auf den übersteigenden Betrag keine Sozialversicherungsbeiträge an.
Durchsetzung von Urlaubsabgeltungsansprüchen
Außergerichtliche Geltendmachung
Der erste Schritt zur Durchsetzung von Urlaubsabgeltungsansprüchen sollte immer die außergerichtliche Geltendmachung sein. Eine schriftliche Aufforderung an den Arbeitgeber, die offenen Urlaubstage abzugelten, ist oft ausreichend, um eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.
Die schriftliche Geltendmachung sollte präzise sein und die Berechnung der beanspruchten Urlaubstage sowie der geforderten Abgeltungssumme enthalten. Auch eine angemessene Frist zur Zahlung sollte gesetzt werden.
Arbeitsgerichtliches Verfahren
Reagiert der Arbeitgeber nicht oder bestreitet er die Ansprüche, bleibt oft nur der Weg zum Arbeitsgericht. Für Urlaubsabgeltungsansprüche sind die Arbeitsgerichte nach § 2 ArbGG zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) und der Zivilprozessordnung (ZPO).
In der ersten Instanz vor dem Arbeitsgericht trägt jede Partei ihre eigenen Anwaltskosten, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Dies erleichtert Arbeitnehmern den Zugang zum Recht. Bei höheren Streitwerten oder in den Berufungs- und Revisionsinstanzen können jedoch erhebliche Kosten entstehen.
Beweislast und Dokumentation
Bei der gerichtlichen Durchsetzung trägt der Arbeitnehmer die Beweislast für das Bestehen seiner Urlaubsansprüche. Daher ist eine sorgfältige Dokumentation der genommenen und noch offenen Urlaubstage essentiell.
Wichtige Beweismittel sind der Arbeitsvertrag, Urlaubsanträge und -genehmigungen, Arbeitszeitaufzeichnungen und die Lohnabrechnung. Auch E-Mails oder andere schriftliche Kommunikation über Urlaubsangelegenheiten können relevant sein.
Präventive Maßnahmen und Empfehlungen
Für Arbeitnehmer
Arbeitnehmer sollten ihre Urlaubsansprüche kontinuierlich im Blick behalten und rechtzeitig Urlaub beantragen. Eine eigene Dokumentation der genommenen und noch offenen Urlaubstage hilft, Streitigkeiten zu vermeiden.
Bei absehbarer Beendigung des Arbeitsverhältnisses sollte frühzeitig das Gespräch mit dem Arbeitgeber über die Abwicklung des Urlaubs gesucht werden. Oft lassen sich einvernehmliche Lösungen finden, die für beide Seiten vorteilhaft sind.
Für Arbeitgeber
Arbeitgeber sollten ihre Mitarbeiter regelmäßig zur Urlaubsnahme anhalten und dabei die gesetzlichen Vorgaben beachten. Eine systematische Urlaubsplanung und -überwachung hilft, Probleme bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen zu vermeiden.
Bei Kündigungen oder Aufhebungsverträgen sollte die Urlaubsabwicklung explizit geregelt werden. Dies schafft Klarheit für beide Seiten und reduziert das Risiko späterer Auseinandersetzungen.
Dokumentation und Aufbewahrung
Beide Seiten sollten alle urlaubsrelevanten Dokumente sorgfältig aufbewahren. Dazu gehören Arbeitsverträge, Urlaubsanträge, Genehmigungen und Ablehnungen sowie die Lohnabrechnungen. Die Aufbewahrungsfrist beträgt mindestens drei Jahre.
Eine digitale Archivierung kann helfen, die Dokumente dauerhaft verfügbar und durchsuchbar zu halten. Besonders bei Unternehmen mit vielen Mitarbeitern ist ein systematisches Dokumentenmanagement unverzichtbar.
Checkliste: Urlaubsansprüche bei Beendigung
Für Arbeitnehmer:
- Eigene Urlaubsübersicht führen und regelmäßig aktualisieren
- Bei Kündigung sofort prüfen: Wie viele Urlaubstage stehen noch zu?
- Urlaubswunsch frühzeitig anmelden und schriftlich bestätigen lassen
- Bei Verweigerung der Urlaubsgewährung schriftlich Abgeltung fordern
- Arbeitsvertrag und Tarifvertrag auf Ausschlussfristen prüfen
- Alle urlaubsrelevanten Dokumente sammeln und aufbewahren
Für Arbeitgeber:
- Urlaubskonten aller Mitarbeiter regelmäßig aktualisieren
- Mitarbeiter rechtzeitig zur Urlaubsnahme anhalten
- Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Urlaubsabwicklung klären
- Abgeltungsbeträge korrekt berechnen und zeitnah auszahlen
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß abführen
Allgemeine Dokumentation:
- Arbeitsvertrag mit Urlaubsregelungen
- Alle Urlaubsanträge und Genehmigungen/Ablehnungen
- Arbeitszeitaufzeichnungen und Anwesenheitslisten
- Lohnabrechnungen der letzten 13 Wochen vor Beendigung
- Schriftverkehr über Urlaubsangelegenheiten
Sollten Sie Fragen zu Ihren Urlaubsansprüchen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben, unterstützen wir Sie gerne mit unserer arbeitsrechtlichen Expertise. Eine frühzeitige Beratung kann entscheidend für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche sein.
Fazit: Urlaubsrechte erfolgreich durchsetzen
Der Urlaubsanspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist ein komplexes Rechtsgebiet, das sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber vor Herausforderungen stellt. Die gesetzlichen Regelungen des Bundesurlaubsgesetzes bieten einen klaren Rahmen, doch die praktische Umsetzung erfordert genaue Kenntnisse der rechtlichen Feinheiten.
Für Arbeitnehmer ist es wichtig zu wissen, dass sie grundsätzlich Anspruch auf ihren anteiligen Jahresurlaub haben und nicht genommener Urlaub bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses abgegolten werden muss. Eine eigenverantwortliche Nichtnahme des Urlaubs kann unter bestimmten Umständen zum Verlust des Anspruchs führen, es sei denn, der Arbeitnehmer kann begründete, außerhalb seines Einflussbereichs liegende Gründe für die Nichtnahme nachweisen.
Arbeitgeber sollten ihre Mitarbeiter rechtzeitig zur Urlaubsnahme anhalten und bei Beendigungen eine ordnungsgemäße Abwicklung sicherstellen. Dies vermeidet nicht nur rechtliche Probleme, sondern trägt auch zu einem fairen und respektvollen Umgang mit ausscheidenden Mitarbeitern bei.
Eine sorgfältige Dokumentation, frühzeitige Kommunikation und im Zweifel professionelle rechtliche Beratung sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Abwicklung von Urlaubsansprüchen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Häufig gestellte Fragen
Steht mir bei Kündigung automatisch eine Urlaubsabgeltung zu?
Eine Urlaubsabgeltung steht Ihnen nur für nicht genommenen Urlaub zu, den Sie aus betrieblichen Gründen oder wegen der Beendigung nicht mehr nehmen können. Haben Sie eigenverantwortlich auf Urlaub verzichtet, kann der Anspruch unter bestimmten Umständen entfallen, es sei denn, Sie können begründete, außerhalb Ihres Einflussbereichs liegende Gründe nachweisen.
Wie berechnet sich mein anteiliger Urlaubsanspruch bei unterjähriger Beendigung?
Der anteilige Urlaubsanspruch berechnet sich nach der Formel: Jahresurlaub geteilt durch 12 Monate, multipliziert mit den Monaten der Beschäftigung. Angefangene Monate zählen mit, wenn Sie mindestens die Hälfte des Monats beschäftigt waren.
Muss mein Arbeitgeber mir die Urlaubsnahme während der Kündigungsfrist ermöglichen?
Ja, grundsätzlich muss der Arbeitgeber Ihnen die Möglichkeit zur Urlaubsnahme geben. Nur wenn dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich ist, muss er den Urlaub abgelten.
Wie hoch ist die Urlaubsabgeltung?
Die Urlaubsabgeltung entspricht dem durchschnittlichen Arbeitsentgelt der letzten 13 Wochen vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses, einschließlich aller regelmäßigen Vergütungsbestandteile.
Verfällt mein Urlaubsanspruch bei eigener Kündigung?
Nein, auch bei eigener Kündigung behalten Sie Ihren anteiligen Urlaubsanspruch. Sie sollten jedoch frühzeitig Ihren Urlaubswunsch anmelden.
Was passiert mit Urlaub aus dem Vorjahr?
Urlaub aus dem Vorjahr muss grundsätzlich bis zum 31. März genommen werden. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist auch übertragener Urlaub abzugelten, sofern er nicht bereits verfallen ist.
Gelten für die Urlaubsabgeltung besondere Fristen?
Urlaubsabgeltungsansprüche verjähren grundsätzlich nach drei Jahren. Arbeitsverträge können jedoch kürzere Ausschlussfristen vorsehen, daher sollten Sie Ihre Ansprüche zeitnah geltend machen.
Muss ich Steuern auf die Urlaubsabgeltung zahlen?
Ja, Urlaubsabgeltungen unterliegen der Lohnsteuer und sind als Arbeitslohn zu behandeln. Hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge gelten die üblichen Beitragspflichten, soweit die Beitragsbemessungsgrenzen nicht überschritten werden.
Was kann ich tun, wenn mein Arbeitgeber die Urlaubsabgeltung verweigert?
Zunächst sollten Sie Ihre Ansprüche schriftlich geltend machen. Hilft dies nicht, können Sie Ihre Ansprüche vor dem Arbeitsgericht einklagen.
Kann ich bei einem Aufhebungsvertrag auf Urlaubsabgeltung verzichten?
Grundsätzlich ja, aber nur gegen angemessene Gegenleistung. Ein vollständiger Verzicht ohne Ausgleich kann unwirksam sein. Lassen Sie sich hierzu beraten.